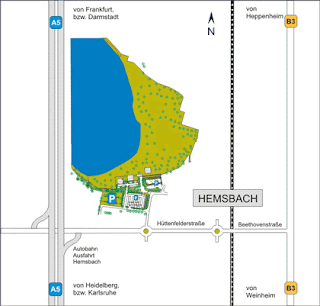Montag, 15. August 2011
Vorschau: Literaturzelt am See der Sinne
Bereits zum dritten Mal findet in Hemsbach die Veranstaltung See der Sinne statt.
Dieses Jahr sind auch die Autoren der LitOff dabei.
Ort: Hemsbach am See (im Rhein-Neckar-Kreis).
Zeit: Samstag, 27. August, 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr.
Vorgestellt werden Texte von Lothar Seidler, Jancu Sinca, Olga Manj, Loma Eppendorf, Nils Ehlert, Anette Butzmann und Sven Ivertowski. Genießen Sie unser Programm aus Lyrik, Erzählung, Satire, Krimi, Gothic, Grusel und Erotik in einer sommerlichen Umgebung. Es ist bestimmt auch für Sie etwas dabei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Hier noch eine kleine Anfahrtsskizze:
Donnerstag, 11. August 2011
Vorschau: Sommerfest der Initiative Buchkultur
Am Sonntag, den 21. August, lädt die Initiative Buchkultur zu ihrem fünften Sommerfest ein.
Ort: der Ebertpark in Ludwigshafen, Freigelände vor der Konzertmuschel
Zeit: 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Gleichzeitig mit dem fünften Kultursommerfest feiert man das fünfte Jahr des Bestehens der Initiative Buchkultur. Statt eines Länderbezugs wie bisher werden diesmal regionale Sprachspiele zum Schwerpunkt gemacht. Ein vielschichtiges Programm mit klassischen und modernen Texten und Liedern deutschsprachiger Varianten, darunter Mittelhochdeutsch, Schwyzertütsch (Wilhelm Tell), Schwäbisch, Elsässisch, Österreichisch, Böhmisch, Jiddisch, Berlinerisch (Tucholsky) und natürlich Pfälzisch. Dabei auch Puppenspieler und Drehorgel im Dialekt. Das Ganze wieder eingepackt in Spezialitäten aus den dargebotenen Regionen, Essen und Trinken (von Slow Food), Musik, Spiele und ein umfangreiches Kinderprogramm.
Veranstalter: Initiative Buchkultur: Das Buch e.V.
Kooperationspartner: Förderverein Ebertpark e.V., Slow Food Pfalz e.V.
Dienstag, 9. August 2011
Vorschau: Lesung Claudia Schmid
Am Freitag, den 12. August, stellt Claudia Schmid ihr neues Buch
Die brennenden Lettern in Ludwigshafen vor.
Beginn der Veranstaltung: 18:00 Uhr
Ort: Garten des Aussiedlerhofes Dieter Kreiselmeier, Kreuzgraben 28, Ludwigshafen-Ruchheim
Und darum geht es in Die brennenden Lettern:
Ein Christ und ein Jude geben im 16. Jahrhundert gemeinsam hebräische Bibeln und andere religiöse Schriften heraus. Der historische Roman von Claudia Schmid ist eine spannende Zeitreise in die Epoche der Reformation und der frühen Druckgeschichte. Der Erzähler erlebt mit wie der Reformator Paul Fagius in Isny die erste hebräische Druckerei im deutschen Sprachraum einrichtet und gemeinsam mit dem zu Fuß aus Venedig kommenden jüdischen Gelehrten Elias Levitha rund zwanzig Schriften herausgibt und vertreibt. Doch immer ist Zacharias Rugus, sein geheimer und gefährlicher Gegenspieler, in der Nähe.
Eine Lesung zwischen biblischen Pflanzen im Garten.
Sonntag, 7. August 2011
Kurzgeschichte des Monats
Die Kurzgeschichte des Monats August stammt von Claus Probst:
Das Gesetz zum Schutz der Dunkelheit
Wer seit Jahren ertrinkt, kann das Wasser nicht lieben. An Manches gewöhnt man sich nie. Gewisse Erlebnisse sind gewöhnungsresistent. Das mit dem Wasser in die Lungen einströmende Gefühl des Erstickens ist dieser Kategorie zweifellos zuzurechnen. Auch hundertfach durchlebt will es einfach nichts von seinem Schrecken verlieren, eine Angst ohne Verfallsdatum, die mich verfolgt, so lange ich zurückdenken kann, ja selbst so lange Richard zurückdenken kann, und Richard vergisst nie etwas. Schon vor Jahren, als ich ihn noch Vater nannte und mich in seinen Gesichtszügen wiederzuerkennen glaubte, versuchte er beharrlich und erfolglos, mich mit dem Wasser auszusöhnen. Gelegentlich ging er dabei mit erstaunlicher Subtilität vor und einer Raffinesse, die man einem grobschlächtigen Körper kaum zugetraut hätte.
Ich erinnere mich noch gut an einen Trinkhalm, sicherlich den schönsten Trink-
halm, den ich jemals gesehen hatte. Ich stieß wie zufällig in der Küche auf ihn, ein wahres Prachtexemplar, das in allen Regenbogenfarben schimmerte und sich sacht an den Rand eines Glases lehnte, umgeben von Mineralwasser, das prickelnd kleine Luftbläschen ausstieß, mit einem leisen Zischen, wie das einer Schlange, die nur darauf lauerte, mich durch ihre Tarnung täuschen zu können. Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte mir Richard ein - wie ich heute zugeben muss - wunderschönes Aquarium und machte mir heftige Vorwürfe wegen jedes einzelnen Todesfalls, der die farbenprächtige Fischpopulation weiter dahinschrumpfen ließ. Meist waren seine strategischen Manöver recht komplex, doch ließ er sich gelegentlich auch zu einem offenen Angriff hinreißen, und ich erinnere mich daran, wie ich während der Sommermonate den Garten mit animalischer Wachsamkeit durchwanderte, ständig darauf gefasst, dass er hinter einem der Büsche hervorspringen und mir den Wasserschlauch genau vors Gesicht halten könnte. Des Streitens überdrüssig trafen wir schließlich eine Übereinkunft, die Richard als den kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnete: Ich erklärte mich bereit, das Wasser ohne Wenn und Aber in die tägliche Körperhygiene einzubinden, und er bewegte einen befreundeten Internisten dazu, mir eine Chlorallergie zu attestieren, eine Diagnose, die mich dauerhaft von der Pflicht entband, in der Schule am Schwimmunterricht teilnehmen zu müssen.
Ein weiteres Zugeständnis an Richard stellten unsere gemeinsamen Angel-
ausflüge dar, wobei ich mich mit dem Gedanken tröstete, dass mein Entgegen-
kommen genauso gut als heimliche Rache verstanden werden konnte. Aber so viele Fische ich dem Fluss auch raubte, so sehr ich der träge dahinfließenden Masse meine Überlegenheit zu demonstrieren versuchte, kaum wurde mein Gehirn durch den Schlaf seines Bewusstseins beraubt, wurden die Verhältnisse zwischen mir und dem Wasser auch schon wieder hergestellt, und wie hunderte Male zuvor versank ich im grünen Licht des immer gleichen Gartenteichs, umgeben von Stichlingen und Libellenlarven und über mir verschwommen ein Gesicht und die Hand, die mich gestoßen hatte, dahinter die Silhouette eines Kirchturms, und dann kamen die Angst und die Gewissheit, sterben zu müssen, und ein gellender Schrei, den niemand hören würde, und der in dem in mich einströmenden Wasser nur feuchtes Blubbern erzeugte.
Warum, schoss es mir durch den Kopf, dann riss mich das Entsetzen jäh aus dem Schlaf. Erleichtert wurde mir klar, dass ich mich auf dem Trockenen befand, und dass die triefende Nässe, die meinen Körper frösteln ließ, nicht den Geruch von Algen in sich trug, sondern das beißende Aroma von Angst und von Schweiß.
Wenige Wochen vor meinem fünfzehnten Geburtstag wurde meine Mutter beim Überqueren der Straße von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Was immer das auch heißen mag. Vermutlich, dass ihr Gehirn durch den Aufprall zerplatzte, noch bevor es erschrecken oder etwas begreifen konnte. Lisa war eine ungemein zerbrechliche Frau gewesen, ängstlich und vorsichtig, ein Mensch, der zeitlebens jedes Risiko vermieden hatte. Dass ausgerechnet sie auf einem Zebrastreifen sterben musste, Einkaufstaschen schleppend und vor sich das grüne Männchen, das ihr aufmunternd entgegenleuchtete, wirkte ernüchternd, so als habe der Tod persönlich klarstellen wollen, dass auch mit Vorsicht nichts gegen ihn auszurichten war.
"Die Welt ist ein Ort ohne Gnade", brach es aus Richard heraus. "Gäbe es irgendeine Alternative, man müsste sie auf der Stelle verlassen. Als befände man sich auf einer gottverdammten Insel, und es gäbe dort nur einziges beschissenes Hotel." Ich sehe noch seine geballten Fäuste vor mir, Fäuste an herunter-
hängenden Armen, die nicht wussten, auf wen sie einschlagen sollten.
Lisa wurde an einem Mittwochmorgen beigesetzt. Eine trockene, bewegungslose Kälte lag über den Gräbern, und der gefrorene Boden knirschte wie eine Warnung unter den Schritten der Trauernden. Nachdem die Karawane der Kondolierenden an uns vorübergezogen war, griff Richard in die Innentasche seines Mantels, brachte mit zitternder Hand eine Zigarette zum Vorschein und starrte mürrisch rauchend hinab auf den mit Erde und Rosen bedeckten Sarg. Als von der Zigarette nur noch der Filter übrig geblieben war und die Hitze der Glut seine Finger zu erreichen drohte, ging ein Ruck durch seinen Körper. Mit der Miene eines Mannes, der soeben eine bedeutsame Entscheidung getroffen hat, suchte er die Verbindung zu meinen Augen.
"Da gibt es etwas, das ich dir sagen muss." Seine Stimme klang heiser. Der Rest der Trauergemeinde hatte sich diskret entfernt und uns allein am Grab zurückgelassen. Übrig geblieben waren nur zwei Totengräber, die etwa fünfzig Meter entfernt darauf lauerten, dass wir endlich verschwinden würden und sie ihr Werk in Ruhe vollenden könnten.
"Lisa war eine wunderbare Frau. Sie hat dich über alles geliebt, das weißt du sehr gut." Einen Moment lang hielt er inne. "Aber sie war nicht deine Mutter."
(...)
Entnommen aus:
Claus Probst Das Gesetz zum Schutz der Dunkelheit
Erschienen im seidler-verlag.de
13,80 EUR ISBN 978-3-931382-42-1
Das Gesetz zum Schutz der Dunkelheit
Wer seit Jahren ertrinkt, kann das Wasser nicht lieben. An Manches gewöhnt man sich nie. Gewisse Erlebnisse sind gewöhnungsresistent. Das mit dem Wasser in die Lungen einströmende Gefühl des Erstickens ist dieser Kategorie zweifellos zuzurechnen. Auch hundertfach durchlebt will es einfach nichts von seinem Schrecken verlieren, eine Angst ohne Verfallsdatum, die mich verfolgt, so lange ich zurückdenken kann, ja selbst so lange Richard zurückdenken kann, und Richard vergisst nie etwas. Schon vor Jahren, als ich ihn noch Vater nannte und mich in seinen Gesichtszügen wiederzuerkennen glaubte, versuchte er beharrlich und erfolglos, mich mit dem Wasser auszusöhnen. Gelegentlich ging er dabei mit erstaunlicher Subtilität vor und einer Raffinesse, die man einem grobschlächtigen Körper kaum zugetraut hätte.
Ich erinnere mich noch gut an einen Trinkhalm, sicherlich den schönsten Trink-
halm, den ich jemals gesehen hatte. Ich stieß wie zufällig in der Küche auf ihn, ein wahres Prachtexemplar, das in allen Regenbogenfarben schimmerte und sich sacht an den Rand eines Glases lehnte, umgeben von Mineralwasser, das prickelnd kleine Luftbläschen ausstieß, mit einem leisen Zischen, wie das einer Schlange, die nur darauf lauerte, mich durch ihre Tarnung täuschen zu können. Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte mir Richard ein - wie ich heute zugeben muss - wunderschönes Aquarium und machte mir heftige Vorwürfe wegen jedes einzelnen Todesfalls, der die farbenprächtige Fischpopulation weiter dahinschrumpfen ließ. Meist waren seine strategischen Manöver recht komplex, doch ließ er sich gelegentlich auch zu einem offenen Angriff hinreißen, und ich erinnere mich daran, wie ich während der Sommermonate den Garten mit animalischer Wachsamkeit durchwanderte, ständig darauf gefasst, dass er hinter einem der Büsche hervorspringen und mir den Wasserschlauch genau vors Gesicht halten könnte. Des Streitens überdrüssig trafen wir schließlich eine Übereinkunft, die Richard als den kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnete: Ich erklärte mich bereit, das Wasser ohne Wenn und Aber in die tägliche Körperhygiene einzubinden, und er bewegte einen befreundeten Internisten dazu, mir eine Chlorallergie zu attestieren, eine Diagnose, die mich dauerhaft von der Pflicht entband, in der Schule am Schwimmunterricht teilnehmen zu müssen.
Ein weiteres Zugeständnis an Richard stellten unsere gemeinsamen Angel-
ausflüge dar, wobei ich mich mit dem Gedanken tröstete, dass mein Entgegen-
kommen genauso gut als heimliche Rache verstanden werden konnte. Aber so viele Fische ich dem Fluss auch raubte, so sehr ich der träge dahinfließenden Masse meine Überlegenheit zu demonstrieren versuchte, kaum wurde mein Gehirn durch den Schlaf seines Bewusstseins beraubt, wurden die Verhältnisse zwischen mir und dem Wasser auch schon wieder hergestellt, und wie hunderte Male zuvor versank ich im grünen Licht des immer gleichen Gartenteichs, umgeben von Stichlingen und Libellenlarven und über mir verschwommen ein Gesicht und die Hand, die mich gestoßen hatte, dahinter die Silhouette eines Kirchturms, und dann kamen die Angst und die Gewissheit, sterben zu müssen, und ein gellender Schrei, den niemand hören würde, und der in dem in mich einströmenden Wasser nur feuchtes Blubbern erzeugte.
Warum, schoss es mir durch den Kopf, dann riss mich das Entsetzen jäh aus dem Schlaf. Erleichtert wurde mir klar, dass ich mich auf dem Trockenen befand, und dass die triefende Nässe, die meinen Körper frösteln ließ, nicht den Geruch von Algen in sich trug, sondern das beißende Aroma von Angst und von Schweiß.
Wenige Wochen vor meinem fünfzehnten Geburtstag wurde meine Mutter beim Überqueren der Straße von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Was immer das auch heißen mag. Vermutlich, dass ihr Gehirn durch den Aufprall zerplatzte, noch bevor es erschrecken oder etwas begreifen konnte. Lisa war eine ungemein zerbrechliche Frau gewesen, ängstlich und vorsichtig, ein Mensch, der zeitlebens jedes Risiko vermieden hatte. Dass ausgerechnet sie auf einem Zebrastreifen sterben musste, Einkaufstaschen schleppend und vor sich das grüne Männchen, das ihr aufmunternd entgegenleuchtete, wirkte ernüchternd, so als habe der Tod persönlich klarstellen wollen, dass auch mit Vorsicht nichts gegen ihn auszurichten war.
"Die Welt ist ein Ort ohne Gnade", brach es aus Richard heraus. "Gäbe es irgendeine Alternative, man müsste sie auf der Stelle verlassen. Als befände man sich auf einer gottverdammten Insel, und es gäbe dort nur einziges beschissenes Hotel." Ich sehe noch seine geballten Fäuste vor mir, Fäuste an herunter-
hängenden Armen, die nicht wussten, auf wen sie einschlagen sollten.
Lisa wurde an einem Mittwochmorgen beigesetzt. Eine trockene, bewegungslose Kälte lag über den Gräbern, und der gefrorene Boden knirschte wie eine Warnung unter den Schritten der Trauernden. Nachdem die Karawane der Kondolierenden an uns vorübergezogen war, griff Richard in die Innentasche seines Mantels, brachte mit zitternder Hand eine Zigarette zum Vorschein und starrte mürrisch rauchend hinab auf den mit Erde und Rosen bedeckten Sarg. Als von der Zigarette nur noch der Filter übrig geblieben war und die Hitze der Glut seine Finger zu erreichen drohte, ging ein Ruck durch seinen Körper. Mit der Miene eines Mannes, der soeben eine bedeutsame Entscheidung getroffen hat, suchte er die Verbindung zu meinen Augen.
"Da gibt es etwas, das ich dir sagen muss." Seine Stimme klang heiser. Der Rest der Trauergemeinde hatte sich diskret entfernt und uns allein am Grab zurückgelassen. Übrig geblieben waren nur zwei Totengräber, die etwa fünfzig Meter entfernt darauf lauerten, dass wir endlich verschwinden würden und sie ihr Werk in Ruhe vollenden könnten.
"Lisa war eine wunderbare Frau. Sie hat dich über alles geliebt, das weißt du sehr gut." Einen Moment lang hielt er inne. "Aber sie war nicht deine Mutter."
(...)
Entnommen aus:
Claus Probst Das Gesetz zum Schutz der Dunkelheit
Erschienen im seidler-verlag.de
13,80 EUR ISBN 978-3-931382-42-1
Gedicht des Monats
Das Gedicht des Monats August stammt von Gisela Hübner:
Unruhe
wisch mich von deiner stirn
fort wie den schweiß
morgens nach einem
rot gescheckten traum
solltest du irgendwo
einen knopf von mir finden
eine liedernote
unseres liebesgesangs
lass sie hinter
unsere matratze rollen
doch presse zwischen
den weißen seiten
unserer geschichte
alle unsere küsse
meine letzten sätze verteile
an die nachbarskinder
allein
das fragezeichen
hänge als unruhe
dir unter die zimmerdecke
Entnommen aus:
Gisela Hübner Zweisam
Erschienen im seidler-verlag.de
9,30 EUR ISBN 978-3-931382-47-6
Unruhe
wisch mich von deiner stirn
fort wie den schweiß
morgens nach einem
rot gescheckten traum
solltest du irgendwo
einen knopf von mir finden
eine liedernote
unseres liebesgesangs
lass sie hinter
unsere matratze rollen
doch presse zwischen
den weißen seiten
unserer geschichte
alle unsere küsse
meine letzten sätze verteile
an die nachbarskinder
allein
das fragezeichen
hänge als unruhe
dir unter die zimmerdecke
Entnommen aus:
Gisela Hübner Zweisam
Erschienen im seidler-verlag.de
9,30 EUR ISBN 978-3-931382-47-6
Montag, 1. August 2011
Tipp für Autoren - rein in die Blogosphäre!

Gerade habe ich erfahren, dass zwei Bloggerinnen demnächst meinen Roman Die Frau am Fenster besprechen werden.
Und zwar Sylvia von Herzbücher und Anka von Ankas Geblubber.
Bislang sind meine Erfahrungen in der Blogosphäre sehr gut. Ich habe bei fünf Bloggerinnen angefragt, ob sie mein Werk lesen möchten. Ergebnis: vier haben zugesagt, eine musste aus Zeitgründen absagen. Jeder Autor weiß, dass die Erfolgsrate bei herkömmlichen Medien meist deutlich geringer ist.
Dabei sollte man dieses neue Medium keinesfalls unterschätzen. Viele Verlage verschicken bereits ebenso viele Rezensionsexemplare an Blogger wie an Zeitungen - das muss einen Grund haben!
Deshalb kann ich allen Autoren nur empfehlen: rein in die Blogosphäre! Es gibt Blogs für jeden Geschmack, schöne Literatur, Krimis, Fantasy, Historisches usw... Dadurch verkauft man immer ein paar zusätzliche Exemplare und - auch nicht zu verachten - es gibt weitere Einträge bei den Suchmaschinen.
Viel Erfolg
Elk
Samstag, 30. Juli 2011
Kurzgeschichte des Monats
Die Kurzgeschichte des Monats Juli stammt von Sven Iwertowski:
Ankunft
Den Abhang rollt etwas Rotes hinunter. Es ist ein Ball. Oben auf dem Hügel die Anstalt, die "Unterbringungsanlage". Neben dem Hügel, in einer Art sumpfigen Mulde, liegen die Baugerüste, die Anstalt expandiert. Doch es ist zu dunkel, sie zu sehen. Nur die Absperrung dämmert noch nach, ein von hinten aus der Anstaltsgartenbeleuchtung sichtbar gemachter Silberstreif vor dem Horizont, der auch schon nicht mehr zu sehen ist.
Man ist versucht, die Anstalt für ein Erholungsheim oder Hotel zu halten - wäre da nicht der Zaun, der mehr danach aussieht, als solle er Wanderer am Eindringen hindern - was nicht ganz unrichtig ist, denn diese würden den Heilungsprozess der Insassen stören. Oder ein Irrer, der aus einem der abschließbaren, gut abschließbaren Zimmer entflohen ist und die Flure oder den Park durchstreift.
Die Irren werden vom Pflegepersonal, das fast durchsichtig die Flure auf- und abläuft, wieder in ein Zimmer gebracht, ein neues Zimmer, noch karger als das alte, um die Bestrafung ganz unterschwellig wirken zu lassen. Der Eingang ist offen und hell beleuchtet, in einem Wirrwarr verschiedener Baustile, mit neoklassizistischen Reliefs, die Säulen vortäuschen, an den Seiten der kirchenartigen Flügeltür. Die Tür selbst, scheinbar im gotischen Stil verfertigt, ist an beiden Seiten beleuchtet, und führt in den Vorraum, ein nüchternes Zimmer mit Plastikschalensitzen in Apfelgrün und einem Glaskasten, in dem eine bunt geschminkte Schwester sitzt und immer nickt, die ganze Zeit nickt und nickt und wartet, dass ein Patient sich anmeldet (denn hier meldet man sich selbst an) - wobei sich die Frage stellt, ob sie immer noch nicken würde, wenn niemand im Raum wäre, aber eigentlich stellt sich die Frage nicht, denn es ist immer, Tag und Nacht, zu jeder Zeit, jemand im Raum; ein Patient, ein zukünftiger Patient, der die Voruntersuchungen noch durchlaufen muss, damit festgestellt wird, woran er leidet, denn jeder, der kommt, hat einen Grund, ein Zimmer zu beziehen, es ist ihm oft nur nicht klar, viele denken nicht ein Mal, nicht ein einziges Mal daran, dass dies überhaupt eine Anstalt ist. Sie wissen nicht um ihre Krankheit, die sich in ihnen ausbreitet, sie verspüren keine Schmerzen, sie sind nicht verhaltens-auffällig, nur richten sie sich in ihrem Zimmer ein, als wäre es eine permanente Wohnstatt. Es sind die meisten, die sich einrichten, und die meisten davon sind untherapierbar.
Die Therapie selbst ist darauf ausgerichtet, den Kranken fester einzureden, dass sie gar nicht krank seien, vielmehr alles normal, ganz normal ist, denn, so die niemals ausgesprochene Maxime, wer das glaubt, der kann auch wieder entlassen werden, eigentlich ist die wahre, die funktionierende Gesellschaft nur die Anstalt, und nur in der Anstalt möglich; deshalb der Anbau. Die Anstalt expandiert.
Die Anstalt hat viele Stockwerke. Auf den unteren Ebenen sind die leichteren Fälle untergebracht, bis hinauf zum Dachboden steigert sich die Schwere der Krankheit, die a-sozialen Fälle dicht unter dem Dach voller Gerümpel; im Keller schließlich sind die Anti-Sozialen untergebracht, Untherapierbare, sabbernde Schreiende, Wahnsinnige, denen der weiße Schaum aus schmilzenden schwarzstumpfen Augen rinnt, wie Morgentau und Abendtau, die nicht von der Therapie überzeugt werden können, aber an der Möglichkeit zur Therapie sich abarbeiten, sich geistig abstoßen - diejenigen, die den Gesundungserfolg der anderen gefährden.
Neben dem Aufzug, dem neumodischen Aufzug, der alles verbindet, bis hinauf auf den Dachboden mit dem Gerümpel, den abgelegten Sachen aus früheren Zeiten der Anstalt, gibt es noch die weitaus schwierigere Möglichkeit der steilen, engen Treppen, die, einst die Hauptverbindungen, nunmehr eine Art von Notverbindungen zwischen den scheinbar auseinanderdriftenden Stockwerken sind. Alle Zeit ist eine Zeit. Alle Räume sind ein Raum. Am Ende jenes langen Flurs, an beiden Seiten mit Türen versehen, befindet sich die steile enge Treppe, deren Ersteigen schon die körperliche Erschöpfung bedeutet, die die geistige Erschöpfung der nächsthöheren Ebene bereits vorher anzeigt. Aber die geistige Erschöpfung beginnt schon auf der Treppe, eine Mattheit, wie das Gefühl einer Erschaffung aus Zerstückelung. Jede Zeit ist eine Zeit. Jeder Raum ist ein Raum.
Die Schwester im Glaskasten nickt weiter, wobei sie die zukünftigen Patienten betrachtet, mit jenem verständnisvoll hohlen Blick, der denjenigen gilt, die krank sind, ohne dass sie die Möglichkeit besitzen, ihre Krankheit vorzustellen.
Es geht den Flur hinab.
Entnommen aus:
Sven Iwertowski Zimmerflucht
Erschienen im seidler-verlag.de
EUR 12,90 ISBN: 978-3-931382-48-3
Ankunft
Den Abhang rollt etwas Rotes hinunter. Es ist ein Ball. Oben auf dem Hügel die Anstalt, die "Unterbringungsanlage". Neben dem Hügel, in einer Art sumpfigen Mulde, liegen die Baugerüste, die Anstalt expandiert. Doch es ist zu dunkel, sie zu sehen. Nur die Absperrung dämmert noch nach, ein von hinten aus der Anstaltsgartenbeleuchtung sichtbar gemachter Silberstreif vor dem Horizont, der auch schon nicht mehr zu sehen ist.
Man ist versucht, die Anstalt für ein Erholungsheim oder Hotel zu halten - wäre da nicht der Zaun, der mehr danach aussieht, als solle er Wanderer am Eindringen hindern - was nicht ganz unrichtig ist, denn diese würden den Heilungsprozess der Insassen stören. Oder ein Irrer, der aus einem der abschließbaren, gut abschließbaren Zimmer entflohen ist und die Flure oder den Park durchstreift.
Die Irren werden vom Pflegepersonal, das fast durchsichtig die Flure auf- und abläuft, wieder in ein Zimmer gebracht, ein neues Zimmer, noch karger als das alte, um die Bestrafung ganz unterschwellig wirken zu lassen. Der Eingang ist offen und hell beleuchtet, in einem Wirrwarr verschiedener Baustile, mit neoklassizistischen Reliefs, die Säulen vortäuschen, an den Seiten der kirchenartigen Flügeltür. Die Tür selbst, scheinbar im gotischen Stil verfertigt, ist an beiden Seiten beleuchtet, und führt in den Vorraum, ein nüchternes Zimmer mit Plastikschalensitzen in Apfelgrün und einem Glaskasten, in dem eine bunt geschminkte Schwester sitzt und immer nickt, die ganze Zeit nickt und nickt und wartet, dass ein Patient sich anmeldet (denn hier meldet man sich selbst an) - wobei sich die Frage stellt, ob sie immer noch nicken würde, wenn niemand im Raum wäre, aber eigentlich stellt sich die Frage nicht, denn es ist immer, Tag und Nacht, zu jeder Zeit, jemand im Raum; ein Patient, ein zukünftiger Patient, der die Voruntersuchungen noch durchlaufen muss, damit festgestellt wird, woran er leidet, denn jeder, der kommt, hat einen Grund, ein Zimmer zu beziehen, es ist ihm oft nur nicht klar, viele denken nicht ein Mal, nicht ein einziges Mal daran, dass dies überhaupt eine Anstalt ist. Sie wissen nicht um ihre Krankheit, die sich in ihnen ausbreitet, sie verspüren keine Schmerzen, sie sind nicht verhaltens-auffällig, nur richten sie sich in ihrem Zimmer ein, als wäre es eine permanente Wohnstatt. Es sind die meisten, die sich einrichten, und die meisten davon sind untherapierbar.
Die Therapie selbst ist darauf ausgerichtet, den Kranken fester einzureden, dass sie gar nicht krank seien, vielmehr alles normal, ganz normal ist, denn, so die niemals ausgesprochene Maxime, wer das glaubt, der kann auch wieder entlassen werden, eigentlich ist die wahre, die funktionierende Gesellschaft nur die Anstalt, und nur in der Anstalt möglich; deshalb der Anbau. Die Anstalt expandiert.
Die Anstalt hat viele Stockwerke. Auf den unteren Ebenen sind die leichteren Fälle untergebracht, bis hinauf zum Dachboden steigert sich die Schwere der Krankheit, die a-sozialen Fälle dicht unter dem Dach voller Gerümpel; im Keller schließlich sind die Anti-Sozialen untergebracht, Untherapierbare, sabbernde Schreiende, Wahnsinnige, denen der weiße Schaum aus schmilzenden schwarzstumpfen Augen rinnt, wie Morgentau und Abendtau, die nicht von der Therapie überzeugt werden können, aber an der Möglichkeit zur Therapie sich abarbeiten, sich geistig abstoßen - diejenigen, die den Gesundungserfolg der anderen gefährden.
Neben dem Aufzug, dem neumodischen Aufzug, der alles verbindet, bis hinauf auf den Dachboden mit dem Gerümpel, den abgelegten Sachen aus früheren Zeiten der Anstalt, gibt es noch die weitaus schwierigere Möglichkeit der steilen, engen Treppen, die, einst die Hauptverbindungen, nunmehr eine Art von Notverbindungen zwischen den scheinbar auseinanderdriftenden Stockwerken sind. Alle Zeit ist eine Zeit. Alle Räume sind ein Raum. Am Ende jenes langen Flurs, an beiden Seiten mit Türen versehen, befindet sich die steile enge Treppe, deren Ersteigen schon die körperliche Erschöpfung bedeutet, die die geistige Erschöpfung der nächsthöheren Ebene bereits vorher anzeigt. Aber die geistige Erschöpfung beginnt schon auf der Treppe, eine Mattheit, wie das Gefühl einer Erschaffung aus Zerstückelung. Jede Zeit ist eine Zeit. Jeder Raum ist ein Raum.
Die Schwester im Glaskasten nickt weiter, wobei sie die zukünftigen Patienten betrachtet, mit jenem verständnisvoll hohlen Blick, der denjenigen gilt, die krank sind, ohne dass sie die Möglichkeit besitzen, ihre Krankheit vorzustellen.
Es geht den Flur hinab.
Entnommen aus:
Sven Iwertowski Zimmerflucht
Erschienen im seidler-verlag.de
EUR 12,90 ISBN: 978-3-931382-48-3
Abonnieren
Posts (Atom)